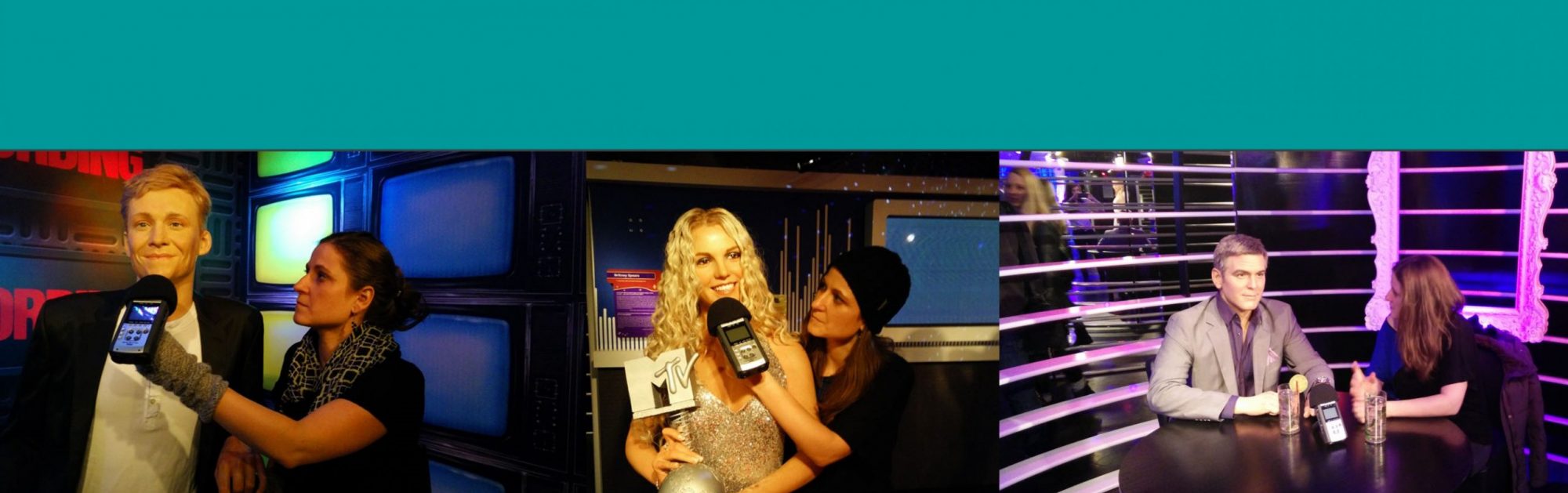Erinnerungsprozesse beschäftigen den israelischen Videokünstler Omer Fast immer wieder in seinen Werken. In seinem Langfilmdebüt „Remainder“ holt Fast nun Kunst ins Kino. Der Wahlberliner spricht im Interview über eine Welt ohne klare Antworten, die performative Rolle der eigenen Identität und warum „Remainder“ kein Thriller ist.
Kurzinhalt von „Remainder“
Ein Mann wacht nach einem schweren Unfall aus dem Koma auf. Er erschafft mit Hilfe seiner Erinnerungsfetzen und die Macht des Geldes eine eigene Wirklichkeit. Die Vision entfaltet eine immer größere Sprengkraft.
Omer Fast über Erinnerungsprozesse im Film
Omer, Du bist Experimentalfilmer und entschieden sich bei Deinem Langfilmdebüt für die Verfilmung von Tom McCarthys Debütroman „Achteinhalb Millionen“. War dieser Schritt ins Filmbusiness für Dich eine bewusste Entscheidung?
Omer Fast: Nein, gar nicht. Ich würde es auch nicht unbedingt empfehlen. Ich hatte das Buch gelesen und Tom McCarthy kontaktiert, weil wir uns kannten. Wir wollten vielleicht gemeinsam ein kleines Projekt über das Buch machen. Im Gespräch stellte sich heraus, dass die Rechte für „Remainder“ schon vergeben waren. Das war Ende 2010. Es war ein großes Projekt mit einem bekannten Regisseur. Sie arbeiteten sich tot und erreichten eine Sackgasse.
Und dann hast Du das Projekt übernommen. Im Roman werden Wirklichkeit und Traum miteinander verwebt. Wusstest Du während der Lektüre des gleichnamigen Buches schon, dass Du das Buch gerne verfilmen möchtest?
Fast: Nein. Ich hab`s erst nach dem dritten Treffen mit der Produktion verstanden, dass wir vielleicht daraus einen Film machen werden. Wenn man sich mit so einem Stoff befasst, dann ist bleibt alles abstrakt. Man spricht zwar die ganze Zeit mit großer Überzeugung darüber, wie man den Stoff realisieren würde, aber es bleibt sehr unwahrscheinlich, dass man daraus einen Film macht. Weil ich in der Kunst arbeite war es mir total unklar, wie das alles funktioniert, woher das Geld kommt, wie war das machen und wann. Ob wir überhaupt drehen würden.
Was faszinierte Dich an dem Roman?
Fast: Ich kann das nicht wirklich erklären. In meiner Arbeit kommen öfter Leute vor, die eine extreme Situation überlebt haben und dann aus dem Nichts versuchen, ihre neue Position zu finden. Sie suchen eine gewisse Sprache, um sich wieder in die Gesellschaft einzufügen. Das ist auch in dem Buch so. Der Roman setzt auch eine Parallele zu dem Leben eines Künstlers und spielt damit. Der Typ wird vom Opfer zum Diktator innerhalb der Erzählung und versucht im Sinne der historischen Avantgarde die Kunst und das Leben zusammenzuführen und ineinander zu verschmelzen.
Vom Opfer zum Diktator: Spielt Deine Herkunft aus Israel da auch eine Rolle?
Fast: Ich verstehe was Sie sagen möchten, aber der Film hat sehr wenig, wenn überhaupt, etwas mit Israel zu tun. Der Protagonist versteht sich nicht als Gentrifizierer, als Künstler oder eine Art Robinson Crusoe, dennoch ist er irgendwo gestrandet. Die Verhältnisse, denen er begegnet, sind ihm sehr fremd und er schafft durch seine Leidenschaft und Visionen, eine gewisse Realität in einem Ort, der für ihn exotisch und fremd ist. Er erwirbt ein großes Haus und verändert die Umstände, damit seine Vision realisiert werden kann. Ganz weit weg sieht man die Bewohner des Hauses, die zu Gunsten seiner Fantasie ausziehen müssen. Es ist Absicht, dass diese Leute bestimmte Hintergründe haben, die ihm sehr unähnlich sind. Man könnte natürlich sagen, dass das seine Entscheidungen mit der Geschichte der Entstehung eines Staates zu tun haben, aber das ist sehr weit hergeholt.
Du arbeitest nun zum ersten Mal als Regisseur eines Spielfilms. Wie unterscheiden sich Kunstprojekt und Spielfilm voneinander?
Fast: Ich habe schon mehrmals mit Schauspielern gearbeitet, insofern ist die Dreharbeit für mich nicht wirklich anders. Ganz anders sind die beiden Systeme oder Wirtschaften. In der Kunst und im Film hat man total unterschiedliche Vorstellungen, wie man mit dem Rohstoff umgeht. Kurz zusammengefasst ist in der Kunst die Freiheit enorm und die Budgets bescheiden und im Film ist es anders
Du hattest doch ein gutes Budget?
Fast: Nein. Es ist ein Low-Budget-Film. Im Verhältnis zu meinen Projekten, die viel bescheidener budgetiert sind, bin ich daran gewöhnt, fünf, sechs, sieben Tage zu drehen und nicht so wie hier 34 Tage zu drehen. Die Beteiligung von Produzenten und Financiers und wie man gemeinsam ein Drehbuch entwickelt war, mir fremd. Normalerweise mache ich das bei mir zu Hause. In der Kunst ist man ziemlich allein, wenn man die Projekte und die Ideen umsetzt. Am Ende ist nur der Künstler für das Projekt verantwortlich. Das ist beim Film anders.
Hast Du das genossen?
Fast: Ja und nein. Ich genieße den Austausch über Ideen. Das ist wunderbar. Es gibt eine gewisse Kollaboration, die man als produktiv und unproduktiv sehen kann. Man hat beides.
In Berlin und London in so wenig Drehtagen zu drehen war doch wahnsinnig herausfordernd. Wusstest Du vorher schon, dass Du in zwei Städten drehst?
Fast: Das hat nur mit der Förderung zu tun. Wir brauchten Berlin nicht unbedingt. Die Geschichte bleibt in London. Man plant das natürlich im Voraus. Natürlich musste man das Drehbuch so teilen und die Szenen finden, die man hier so mehr oder weniger erfolgreich drehen kann. Ganz am Anfang gibt einen Unfall und er rennt eine Straße entlang: Das ist die Friedrichsstraße! Das erkennt man kaum. Es gibt Straßenecken, die relativ ähnlich aussehen. Man darf natürlich nicht den Straßenverkehr zeigen, der andersrum läuft. Die Innenszenen, beispielsweise das Gespräch im Restaurant zwischen den zwei Hauptdarstellern fanden in Neukölln statt und die Kanzlei des Rechtsanwalts war am Hackeschen Markt, drei Minuten von meiner Wohnung entfernt. Insofern war das auch sehr angenehm, hier in Berlin zu drehen.
Nicht das erste Mal beschäftigst Du Dich mit dem Erinnerungsprozess. Warum kommst Du immer wieder darauf zurück?
Fast: Sie sprachen vorhin von dem Politischen. Für mich war das relevant, zu verstehen, dass manche Dinge, die man eher als eigenständig oder als natürlich versteht, öfter performativ oder konstruiert sind. Ich dekonstruiere gerne. Für das politische, das soziale und das psychologische spielt die Vergangenheit eine Riesenrolle. Ohne Vergangenheit sind wir verloren.
„Ich verstand sehr früh, dass die eigene Identität eine riesige performative Rolle hatte.“
Du bist sowohl in Israel, als auch in den USA, New York, aufgewachsen. Welche Rolle spielt Deine Herkunft in Ihren Werken?
Fast: Ich bin mehrmals als Kind umgezogen und in zwei unterschiedlichen Kulturen, Sprachräumen und Ländern aufgewachsen und auch – im kollektiven Sinne – zwei unterschiedlichen Geschichten, die sich dennoch überlappen. Früh verstand ich, dass die eigene Identität eine riesige performative Rolle hat. Zwar konnte ich als Amerikaner oder als Israeli genauso aussehen und klingen wie alle anderen, aber für mich war das immer eine gewisse Inszenierung innerhalb der Gesellschaft. Ich versuche in meiner Arbeit öfter, solche persönlichen Geschichten in Hinblick auf das Performative in unserer Identität und in der Geschichte zu untersuchen und damit zu spielen.
Wie lässt sich Dein Kinofilm in diesen Kontext einordnen?
Fast: „Remainder“ hat vielleicht weniger damit zu tun, aber der Protagonist hat nur diese Erinnerungsfetzen und dieses sehr fragmentierte Selbstverständnis. Am Ende versucht er durch eine sich wiederholende Inszenierung, sein Leben wieder zusammenzufügen. Für ihn kommt das aus einer großen Notwendigkeit heraus, eine Identität dort zu schaffen, wo es keine gibt.
Warum vermischst Du Authentizität mit Illusion?
Fast: In meinen Arbeiten als Künstler versuche ich sehr oft, durch Illusion die Realität zu durchbrechen. Die Frage ist: Welche Möglichkeiten haben wir, um eine Geschichte oder eine Identität zu komponieren? In „Remainder“ bleibt im Grunde die Illusion. Die Geschichte war komplex genug, deshalb wollte ich nicht noch weitere Erzählebenen kreieren. Wir bleiben mit dem Protagonisten in dem Zustand, in dem er am Anfang ist: Er kommt in einem benebelten Zustand zurück in diese Welt. Parallel versuchen die Zuschauer und er herauszufinden, was für eine Rolle er in dieser Welt spielt. Am Ende gibt keinen Schlüssel, um den Film zu verstehen. Und so kehrt der Film ins Künstlerische. Es ist kein Thriller. Man wird am Ende nicht wissen: „Who did all this and why?“ Die Kamera umkreist ihn. Er ist eine Art von Rückenfigur, wie man sie in der Kunst seit Jahrhunderten hat. Genau diese Mehrdeutigkeit wollte ich haben.
Der Protagonist, gespielt von Tom Sturridge, kehrt sich von einer immer mehr fragmentierenden Welt ab, weil er sich nach klaren Antworten sehnt. Funktioniert das?
Fast: Dass die Welt fragmentiert ist, ist eher ein Resultat seines Unfalls. Ganz am Anfang zeigt die Kamera sein Blut und seine Verletzungen. Es ist auch nicht willkürlich, dass man sein Smartphone sieht, das genauso beschädigt wurde. Der Protagonist hat keinen Umgang oder Zutritt in diese virtuelle Welt. Er versucht nicht, sich selbst zu googeln. Das wäre das einfachste. Zu tippen: „Was mache ich hier? Wer bin ich?“ Vielleicht würde er irgendwas herausfinden: Einige Webseiten, eine Facebookpage, SMS-Texte und so weiter. Das macht er nicht. Er macht etwas, was viel altmodischer oder Vergänglicher ist. Er versucht, durch Inszenierungen und durch das Zwischenmenschliche seine Rolle zu definieren und zu finden. Man sieht ihn niemals am Rechner. Man sieht ihn niemals auf Social Media. Er macht das viel klassischer, nostalgischer und dennoch merkwürdiger.
Warum macht er das?
Fast: Ich glaube, für ihn ist diese Welt nicht mehr zugänglich. Er muss eine alternative Methode finden, um eine Identität zu schaffen. Diese Methode wirkt etwas exotisch, weil wir uns heutzutage die ganze Zeit mit unseren Screens beschäftigen. Ich kritisiere das nicht, aber ich wollte auf jeden Fall vermeiden, dass er in eine virtuelle Welt taucht. Seine Welt musste zwar lebensgroß sein, aber sehr theatralisch, sehr inszeniert.
Im Gegensatz zum Buch offenbarst Du die Gedanken der Hauptfigur nicht. Wie wichtig ist das Nichtgesagte?
Fast: Wenn man die Sätze im Buch sammelt, in denen er den anderen Charakteren etwas sagt, würde man auf zwei Seiten oder so kommen. Er hat nicht so viel zu sagen, dennoch ist er im Buch ein Quasselkopf. Es war eine grundlegende Entscheidung, ob wir das voice-over-motiviert erzählen oder ob er schweigt. Mir war wichtig, dass man ihm Raum und Platz gibt, sonst wäre das sehr hektisch. Ich wusste, dass wir sehr stark komprimieren müssen und ich wollte manche Räume schaffen, die mehrdeutig sind, weil man nicht genau erzählt bekommt, was gerade passiert und wie es sich anfühlt.
„Für mich ist reden ein Schlüssel, insofern bin ich sehr freudianisch. Ich glaube an den Prozess.“ (Omer Fast)
Zeichnet das Schweigen Ihre Arbeiten aus?
Fast: Nein, in meinen Arbeiten wird ohne Ende gequatscht. Für mich ist Reden ein Schlüssel, insofern bin ich sehr freudianisch. Ich glaube an den Prozess. Für mich ist das sehr wichtig, dass wir einander Dinge erzählen und in welche Richtung wir gehen müssen.
Warum hast Du Dich in „Remainder“ für den stillen Protagonisten entschieden?
Fast: Der Protagonist taucht auf und man weiß nicht, was er macht. Es war auch wichtig, weil nach dem Unfall in einem traumatisierten Zustand ist, wo Sprache keine Lösung aufzeigt. Er hat keine Lust, mit Leuten zu sprechen. Er sitzt manchmal Leuten gegenüber und schweigt. Durch sein Schweigen wirkt das Gespräch plötzlich sehr merkwürdig. Zum Beispiel gibt es eine Szene mit seinem Anwalt, der ihm Geld anbietet. Der Protagonist will kein Gespräch über das Geld mit ihm führen. Der Protagonist hat eher Bilder im Kopf als Wörter. Aus diesem Leisen, diesem Sprachlosen heraus entsteht sein Schaffen.
Er versucht die Bilder aus seinem Kopf zu rekonstruieren, aber er kann sie gar nicht beschreiben. Schweigt er deshalb so viel?
Fast: Er versucht zu beschreiben, was er denkt, aber es gelingt ihm nicht. Insofern muss er etwas anderes machen, deshalb sind für ihn diese Bilder sehr wichtig. Jedes Mal, wenn er etwas sagt, wird er verhöhnt. Vielleicht gibt es in dem Film kleine Ecken von Humor, die aus seinem Versuch kommen, Sprache zu verwenden.
Auf dem Hausdach des Nachbarhauses befinden sich Katzen. Warum sind die Katzen ein zentrales Element in diesem Film?
Fast: Für mich sind sie Teil einer Inszenierung. Die Katzen auf dem Dach waren auch ein Element im Buch. Für mich waren sie wichtig, weil die Hauptfigur diese Katzen relativ empathielos behandelt. Er hat kein Gefühl für sie.
Gleich danach kommen die Menschen.
Fast: Genau! Auch durch diese Besessenheit, die er hat, verliert der Protagonist das Gefühl. Es frustriert ihn, wenn sich die Katzen nicht auf dem Dach halten können. Dann zeigt er plötzlich eine Bereitschaft, ziemlich hart mit den Umständen umzugehen, um seinen Willen zu realisieren. Insofern war die Szene wichtig, um zu zeigen, dass es eine gewisse harte Entwicklung gibt.
Und die Botschaft des Films ist „Am Ende des Tages kann man sich alles kaufen, auch Menschen“?
Fast: Ja, aber er macht sich nicht glücklich damit. Es ist keine bejahende kapitalistische Aussage. Das Geld bleibt für ihn sehr abstrakt und am Ende auch für uns.
Die Hauptfigur inszeniert auch einen Raub. Wurde der Bankraub eigentlich realistisch dargestellt?
Fast: Nein. Wir haben jemanden eingeladen, der als Banksicherheitsexperte tätig ist und er hat nur gelacht. Er meinte: „Du, da gibt`s nicht viel in einer Bank. Geld gibt`s nicht mehr. Das, was wir aus den 70ern kennen, Leute, die mit großen Beuteln rausrennen, das hat man nicht mehr. Das ist alles virtuell. Geld existiert nicht mehr als Stoff.“
Mehr Informationen über „Remainder“